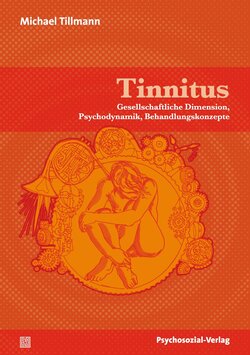235 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm
Erschienen: September 2010
ISBN-13: 978-3-89806-831-4
Bestell-Nr.: 831
Mit einem Vorwort von Rolf Vogt
Tinnitus
Sofort lieferbar. Lieferzeit (D): 4-5 Werktage
Tillmann fragt nach dem unbewussten Sinn des Leidens und beschreibt, wie eine Brücke zum eingekapselten emotionalen Erleben im Unbewussten hergestellt werden kann. Er wendet dabei die wichtigsten entwicklungspsychologischen Konzepte auf den Tinnitus an. Diese erste psychoanalytische Studie zum Thema Tinnitus stützt sich auf viele Jahre klinischer Forschung und richtet sich nicht nur an Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, klinische Psychologen und Ärzte, sondern auch an Betroffene.
Vorwort
Danksagung
Einführung
Teil I Historische und theoretische Abhandlung
1. Geschichte des Hörens aus medizinischer Sicht
Vorbemerkungen
Genealogische Bedeutungskonstruktionen zum Hören und Ge-hören
Medizinhistorische Aspekte und der Prozess der Entsubjektivierung
Ausblick und Fazit
2. Behandlungsformen der Medizin
Vorausblick
Weltweite Zunahme von Tinnitus-Betroffenen
Medikamentöse Therapieversuche
»Prothesen- und Hightech-Medizin« innerhalb ambulanter Therapie
Psychologische und psychotherapeutische Behandlung
Tinnitus: Die verkleidete Hysterie
Abschließende Diskussion
3. Entwicklungspsychologische Aspekte
Vom Tonangeben des Unbewussten in der prä- und postnatalen Hörwelt
Zum ästhetischen Erleben in der menschlichen Entwicklung und aus künstlerischer Perspektive
Teil II Klinischer Teil und Technik
4. Allgemeine Überlegungen zur psychoanalytischen Theoriebildung der Hysterie
Hysterie als Krankheitskonzept historisch betrachtet
Das psychoanalytische Konzept der Hysterie von Freud
Psychosomatische Konzepte
Der Begriff der Konversion und das Konzept der Angstneurose
Die psychosomatische Konzeption von seelischem Konflikt und körperlicher Krankheit
Max Schurs De- und Resomatisierungsmodell
Das Modell der »zweiphasigen Abwehr« von Mitscherlich
Die französische psychosomatische Schule: Pensée opératoire
Klinisch-deskriptive Merkmale der psychosomatischen Struktur
Fazit
5. Lorenzers Theorie: Die Entwicklung des Individuellen
Zusammenfassende Bemerkungen
6. Klinisch-psychoanalytische Theoriebildung zur Hysterie
Theoretisch-konzeptionelle Überlegungen
7. Rupprecht-Schamperas Modell misslungener Separationsversuche
8. Zur Theorie und Technik der Behandlung Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen
9. Die analytische Arbeit im Prozess von Übertragung und Gegenübertragung
Fallvignette
Die erste Begegnung mit dem Patienten
Biografisch bedeutsame Erlebnisse
Zur Behandlung
Fazit
Die zweite Behandlung
10. Schlussbetrachtungen
Literatur
Namenregister
»Das macht dieses Buch so lesenswert und ertragreich nicht nur für Psychotherapeuten und -therapeutinnen, sondern für alle, die beruflich und/oder persönlich interessiert sind am Verstehen der Zusammenhänge von Körperlichem und Seelischem, von Individuellem und Gesellschaftlichem und an einem neuen Blick auf ein Krankheitssymptom unserer Zeit ...«
Dr. Rosemarie Tüpker, Psyche, Heft 1, Januar 2012
»Eine Arbeit, die ein epidemisches Phänomen neu und gründlich erklärt und damit die Perspektive einer erfolgversprechenden Behandlung eröffnen könnte ...«
Helmut Dachale, Deutsches Ärzteblatt, 1/2011
»›Wer nicht fühlen kann, muss hören‹, so könnte man die Botschaft Tillmanns beschreiben ...«
Helmut Schaaf, amazon.de
»Tillmanns theoretische und klinische Studie stellt dies erstmals psychoanalytisch fundiert dar. Der Autor entschlüsselt, was sich psychodynamisch und gesellschaftlich hinter der Symptomatik verbirgt ...«
, ärztemagazin 46/2010, Medizin Medien Austria
»Diese erste psychoanalytische Studie zum Thema Tinnitus stützt sich auf viele Jahre klinischer Forschung und richtet sich nicht nur an Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, klinische Psychologen und Ärzte, sondern auch an Betroffene ...«
Wolfgang Mück, www.dr-mueck.de
»Der Psychoanalytiker entwickelte eine überzeugend scheinende Strategie, die sich von den offenkundig wirkungslosen technisch-medikamentösen Therapien der Gesundheitsindustrie abwendet und auf die Psyche des Patienten setzt ...«
Silvia Ottow, Neues Deutschland vom 27./28. November 2010
»Diese erste psychoanalytische Studie zum Thema Tinnitus stützt sich auf viele Jahre klinischer Forschung und richtet sich nicht nur an Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, klinische Psychologen und Ärzte, sondern auch an Betroffene ...«
Horst Grenz, Literaturblog des Institut50plus
»Tinnitus-Betroffene leiden doppelt: an gesellschaftlichen Veränderungen und an einem inneren Konflikt. Michael Tillmanns theoretische und klinische Studie stellt dies erstmals psychoanalytisch fundiert dar. Die erste psychoanalytische Studie zum Thema Tinnitus stützt sich auf viele Jahre klinischer Forschung und richtet sich an Fachleute und Betroffene ...«
Dorothea Ölbermann, »Die kleine«, Zeitschrift für mehr Mut beim älter Werden, Nr. 11/12, 17. Jahrgang, November/Dezember 2010
»Der Psychoanalytiker setzt mit seinem Ansatz einen deutlichen Kontrapunkt zu den in der Tinnitus-Therapie verbreiteten verhaltenstherapeutischen Konzepten ...«
Antje Donker, SeelsOHRge. Zeitung der Evangelischen Schwerhörigenseelsorge Nr. 14, S. 15
»Tillmanns These: Ein Tinnitus habe nichts mit dem Ohr oder dem Gehirn, sondern mit dem Hören zu tun. ›Es ist etwas unerhört in den Menschen, zu dem man aber einen Zugang finden kann.‹ ...«
, Top Magazin Bremen 4/2011
»Michael Tillmanns Sachbuch ›Tinnitus‹ fesselt: Nicht nur Tinnitus-Betroffenen liefert der Bremer Psychotherapeut und Psychoanalytiker erhellende Einsichten in die zahlreichen Facetten der Krankheit ...«
Bernd Weßels, Tinnitus-Selbsthilfe-Arbeitsgemeinschaft e.V., www.tisag.de
»Ist Tinnitus eine Globalisierungserkrankung? Diese These belegt der Bremer Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker Michael Tillmann in seiner jüngst vorgelegten Dissertation mit dem Titel ›Tinnitus. Gesellschaftliche Dimension, Psychodynamik, Behandlungskonzepte‹ ...«
Eberhard Scholz, Pressemitteilung Nr. 148 der Universität Bremen
»Der Autor entschlüsselt, was sich psychodynamisch und gesellschaftlich hinter der Symptomatik verbirgt ...«
, Main Echo, Mittwoch 11. Mai 2011
»Für Aufsehen aber sorgt derzeit der Bremer Psychotherapeut und Psychoanalytiker Michael Tillmann, der sich dem Tinnitus in seiner Doktorarbeit umfangreich gewidmet hat ...«
Dieter Weirauch, Gesund Magazin (Beilage d. Berliner Morgenpost, Hannoversche Allgemeine, Hamburger Abendblatt, Neue Presse etc.)
»Die Übersicht über die derzeitige Praxis der Tinnitusbehandlung ist beeindruckend realistisch und zeigt klar die Grenzen der medikamentösen und apparativen Therapien. Damit öffnet sich für den Leser zwangsläufig die Sichtweise hin zur psychoanalytischen Beurteilung des Tinnitus, die nun detailliert und komplex dargestellt wird ...«
Oliver Kaschke, Zm Zahnärztliche Mitteilungen Heft 4/2011
»Insgesamt handelt es sich um ein pointiertes Buch, das in der Vielzahl der Tinnitus-Literatur eine exponierte Stellung einnimmt und hier den Akzent sehr deutlich auf den psychoanalytischen Aspekt legt ...«
Dr. med. Helmut Schaaf, Das Tinnitus-Forum 4/2010
»Das Anliegen des vorliegenden Ratgebers ist es, Betroffenen zu helfen, ihr Symptom zu verstehen und sie davon zu überzeugen, den Tinnitus nicht als etwas Angst einflößendes und Feindliches zu betrachten ...«
Dr. Dr. Oskar Meggeneder, Lichtblick. Selbsthilfe oö informiert, Ausgabe März 2010