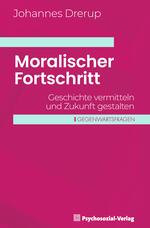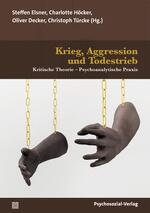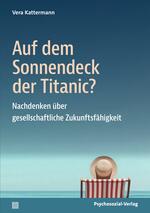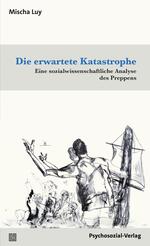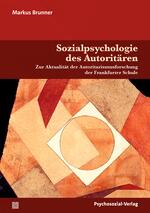Gesellschaft
psychosozial 183: Rassismus
Rassismus in verschiedensten Formen gehört seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, zu
den wirkmächtigsten sozialen Inklusions- und Exklusionsstrategien menschlicher Gesellschaften. Und die Autor:innen dieses Hefts illustrieren und bestätigen, dass Rassismus keinesfalls ein historisches Relikt ist, sondern eine widerspenstige und weltweit lebendige Sozialstruktur, die auch unsere modernen Gesellschaften nach wie vor durchzieht. In ihrer Zusammenschau verdeutlichen die Heftbeiträge, dass eine wirksame Auseinandersetzung mit Rassismus weder bei begrifflichen Tabus noch bei isolierten Einzelanalysen stehen bleiben kann. Erforderlich ist vielmehr eine reflektierte, relationale Perspektive, die historische Kontinuitäten, aktuelle Konfliktlagen und praktische Interventionsmöglichkeiten zusammendenkt. [ mehr ]
Moralischer Fortschritt
Johannes Drerup setzt grassierenden negativen Geschichts- und Zukunftsbildern etwas entgegen: Wir brauchen die Idee des Fortschritts und seiner Möglichkeit, um künftigen Generationen ein angemessenes Bild von Geschichte und demokratisch gestaltbaren Zukünften vermitteln zu können. [ mehr ]
Verzeihen
Joachim Küchenhoff legt die psychosoziale Kraft einer gesellschaftspolitischen und persönlichen »Verzeihensarbeit« frei, die unverzichtbar ist, um mit Scham, Schuld und Schuldgefühlen umzugehen, Verluste und Enttäuschungen ohne Ressentiment und ausgelebte Rachewünsche zu verarbeiten und sich aus Opferrollen befreien zu können. [ mehr ]
Beratung aktuell 2/2025: Mediennutzung und Parasozialität (PDF)
In diesem Themenheft der Beratung aktuell geht es um Mediennutzung und Parasozialität in Therapie und Beratung, mit Beiträgen von u.a. Madita Hardiek zur KI von Eric Hegmann, Diana Pistoll und Kolleginnen zum Thema Social-Media-Beziehungen, Christiane Eichenberg und Julian Krusche zum Thema Online-Tools in der Beratung. [ mehr ]
Trauma Kultur Gesellschaft 4/2025: Klimawandel: (Prä)traumatische Aspekte
Die Erderwärmung führt zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen mit post-traumatischen Auswirkungen. Kann psychotherapeutisches Wissen über Verdrängung, Vermeidung, Dissoziation oder problematische Affektregulierung genutzt werden, um notwendige Trauer- und Schambewältigung zu begleiten und Verhaltensänderungen anzustoßen?
[ mehr ]
Krieg, Aggression und Todestrieb
Wie verhalten sich Psychoanalyse und Kritische Theorie zu menschlicher Aggression und kriegerischen Absichten? Die Beiträger*innen fragen jenseits von aktuellen Kriegsschauplätzen auch nach den Hintergründen alltäglicher Gewalt und Unterdrückung, die sich in Form des ökonomischen Wachstumszwangs und der asymmetrischen Produktion von Reichtum und Armut zeigen. [ mehr ]
Das Ende der Menschenrechte
Wer darf zu uns kommen? Wer wird als illegal markiert? Wo verdichten sich Feindbilder? Heidrun Friese versteht derzeitige Migrationspolitiken als Teil eines Kriegsszenarios und zeigt deren innere Logik von Feindschaft und Todespolitik. Sie formuliert die existenzielle Frage nach der Universalität der Menschenrechte und plädiert für Verantwortung und Rechenschaftspflicht. [ mehr ]
psychosozial 182: Affektive Sozialität - Die Anderen als Adressat:innen eigener Gefühle
Ohne Gefühle ist unser Leben nicht vorstellbar. Sie bestimmen unser Handeln, begleiten unser Denken. Sie gelten gemeinhin als etwas sehr Persönliches oder sogar Individuelles, das sich im »Inneren« eines Menschen abspielt. Doch Gefühle sind nicht nur subjektive, sondern auch eminent soziale Phänomene. Keine Begegnung und Beziehung ist ohne sie denkbar. In diesem Heft sind Beiträge versammelt, die sich überwiegend mit feindlichen Gefühlen wie Ekel, Abscheu, Verachtung, Ressentiments oder auch Hass befassen. Solche Gefühle spielen in gewaltvollen Praxen eine wichtige Rolle – und sie beschäftigen uns meist nachhaltiger als positive, freundliche Gefühle: Stehen sie allein schon tagtäglich im Fokus der Nachrichten aus aller Welt. [ mehr ]
Lebensgeschichte, Interviews, wissenschaftliches Wirken
Seit den 1960ern einer kritischen Psychoanalyse und Psychologie verbunden, kulminierte das zeitdiagnostische Denken des Sozialpsychologen, Psychoanalytikers und Mediziners in seinem Projekt einer historisch ausgerichteten, kulturevolutionären Anthropologie. Einige von Hans Kilians Ideen sind trotz ihrer eigenen zeitlichen Verortung weiterhin aktuell und als wissenschaftsgeschichtliche Zeugnisse intellektuell anregend. Anhand von teils bislang unveröffentlichten Texten und Interviews werden Kilians Leben und Wirken anschaulich. Der Band wird abgerundet mit einer vollständigen Bibliografie seiner Werke. [ mehr ]
Gewalterfahrungen von Jungen und Männern und die Folgen für ihre Gesundheit
Männer sind im jungen Alter häufiger und generell anders als Frauen von Gewalt betroffen. Da Männer jedoch gesellschaftlich in erster Linie als Täter wahrgenommen werden, ist die Forschungslage zu ihren Gewalterlebnissen als Opfer und deren erhebliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit völlig unzureichend. Führende Fachleute haben die verstreuten Erkenntnisse zusammengetragen und präsentieren sie entlang des Lebenslaufes. Ein besonderer Fokus liegt auf Blaulichtberufen und Militär sowie auf vulnerablen Lebenslagen. [ mehr ]
J.L. Moreno
J.L. Moreno (1889–1974), der Vater des Psychodramas, war ein früher Kritiker Sigmund Freuds, war Verfasser und Herausgeber von Schriften der Wiener Moderne und des Existenzialismus, gründete ein experimentelles Theater, beeinflusste Martin Buber und wurde zu einem bedeutenden Psychiater und Sozialwissenschaftler seiner Zeit. Die von seinem Sohn Jonathan D. Moreno geschriebene Biografie verbindet das Leben und die Errungenschaften J.L. Morenos mit den Entwicklungen in der Psychologie und Soziologie. [ mehr ]
Mütter und Andere
Der Ursprung unseres sozialen Verhaltens liegt, so Sarah Blaffer Hrdy, in gemeinschaftlicher Kindererziehung, denn steinzeitliche Mütter und Väter waren angesichts knapper Ressourcen auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Die Autorin erläutert, warum und wie sich aus dieser Form der gemeinschaftlichen Fürsorge entscheidende neue Formen des sozialen Miteinanders sowie die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten der Empathie und Kooperation entwickelten. [ mehr ]
Helfende Hände für geflüchtete Menschen
Die psychosoziale Begleitung von Geflüchteten in der Phase ihres Ankommens in Deutschland wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit und den Integrationsprozess aus. Doch wie kann eine beziehungsorientierte Hilfe gestaltet werden, wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen einer frühzeitigen Begleitung und wie kann diese den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden? [ mehr ]
Freie Assoziation - Zeitschrift für psychoanalytische Sozialpsychologie 1/2025: Die Unwirklichkeit unserer Städte
Ausgabe 1/2025 der Freien Assoziation ist der Auseinandersetzung um gegenwärtige Stadtarchitekturen und den Möglichkeiten eines Neudenkens derselben gewidmet: Wie sieht eine gemeinschaftliche Stadt aus, die sich an den Bewohner:innen orientiert und die großen Zukunftsaufgaben ernstnimmt? [ mehr ]
psychosozial 181: Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus - Inter- und transdisziplinäre Analysen
Die Ausgabe verbindet begriffstheoretische Reflexionen mit historischen Analysen, sozialpsychologischen Fallstudien, geschlechtsspezifischen Perspektiven sowie Untersuchungen zu Herausforderungen in Prävention und Intervention. Ein besonderer Fokus liegt auf bislang marginalisierten Zugängen, insbesondere der Opfer- und Betroffenenperspektive. Mit Beiträgen zur historischen Tiefenstruktur ideologischer Narrative, zu (psycho)sozialen Folgen rechtsterroristischer Anschläge und zur transnationalen Dimension extrem rechter Bewegungen plädiert das Heft für eine umfassende Betrachtung rechtsextremer Phänomene, jenseits verkürzter Deutungsangebote und isolierter Fachlogiken. [ mehr ]
Auf dem Sonnendeck der Titanic?
Vera Kattermann fragt, ob wir aktuelle gesellschaftspolitische Kontroversen besser verstehen können, wenn wir die Vorstellung von uns als Passagieren an Bord der Titanic bemühen, die anfangen, die Abläufe an Bord neu zu regeln, und in Anbetracht zahlreicher Konflikte nach Lösungen suchen. Denn auch für düstere Szenarien gibt es ein Danach, eine dann neu zu gestaltende Welt. [ mehr ]
Schmerz
Leiden und Schmerz sind jedem Menschen vertraut und verbindende Elemente des Menschseins insgesamt. Das psychosomatische Nachdenken über Schmerzstörungen eröffnet einen weiten Raum komplexer Gefühle und konkreter Dimensionen therapeutischer Ansätze. Jenseits des Klinischen kann das Erleben von Vulnerabilität Ausgangspunkt für gesamtgesellschaftliche Veränderungen sein. [ mehr ]
Künstliche Intelligenz und Kränkung
Künstliche Intelligenz bringt psychosoziale Herausforderungen mit sich, insbesondere den Verlust der vermeintlichen menschlichen Einzigartigkeit, was unser Selbstbild als autonome Wesen infrage stellt. Karsten Weber beschreibt die Kränkung, die durch die Entwicklung und den Einsatz von KI verursacht wird. Exemplarisch erörtert er Übergänge und Verluste – und setzt sie in den Kontext anderer globaler Herausforderungen, denen die Menschheit aktuell und in absehbarer Zukunft gegenübersteht. Wie kann ein konstruktiver Umgang mit KI aussehen? Wie können wir mit den Herausforderungen, die KI an uns stellt, gut umgehen? [ mehr ]
Trauma Kultur Gesellschaft 3/2025: Verletzlichkeit - Ausgangspunkte und Aussichten auf ein vieldeutiges Konzept
Verletzlichkeit bewegt sich zwischen Phänomenbeschreibung einerseits und aktiver Begriffsherstellung andererseits. Zwischen Migration, Transgenerationalität, Psychopathologie, Gewalt und Suizidalität loten die Beiträge des Heftes wichtige Dimensionen eines Kernbegriffs der Gegenwart aus. [ mehr ]
Die erwartete Katastrophe
In Interviews mit Prepper*innen spürt Mischa Luy deren persönlichen Motivationen und Überzeugungen nach. Er beschreibt, dass dem Wunsch nach Unabhängigkeit innerhalb katastrophischer Zukunftsszenarien ein starkes Bewusstsein für individuelle und gesellschaftliche Verletzbarkeit zugrunde liegt, das auf persönlichen sowie tradierten Mangelerfahrungen, gesellschaftlichen Krisen und sozialisatorisch erworbenen Wertvorstellungen beruht. [ mehr ]
Trauma Kultur Gesellschaft 2/2025: Ungewissheiten der Gegenwart
Das inhaltlich ungemein breite Themenspektrum der Trauma Kultur Gesellschaft, sich bewegend zwischen schweren seelischen Verletzungen, medizinischen, psychodynamischen und -therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten sowie der gesellschaftlichen Bedeutung und dem kulturellen Umgang mit Traumata, findet seinen Ausdruck in den Ungewissheiten einer komplexen Gegenwart mit ihren zahlreichen Fragestellungen. [ mehr ]
Experimente in Demokratie
Der amerikanische Re-Education-Diskurs der 1930er und 1940er Jahre war geprägt von der Frage, wie mit dem nationalsozialistischen Deutschland nach dem Krieg umzugehen sei. Oliver König zeigt, welche Bedeutung angewandter Sozialpsychologie, Gruppendynamik und Psychoanalyse für eine in Deutschland schrittweise entstehende demokratische Kultur zukommt. [ mehr ]
Die Kindertransporte nach Großbritannien 1938/39
1938/39 wurden etwa 10.000 Kinder nach Großbritannien gebracht, um sie vor dem antisemitischen Terror zu retten. Wie erlebten sie diesen »Transport«, die Ausgrenzungserfahrungen zuvor, die wechselnden Pflegefamilien danach? Wie erinnern sie sich als häufig einzige Überlebende ihrer Familien daran? Maria Jäger zeigt, wie die Kinder von damals im Erzählen ihrer Lebensgeschichten aushandeln, Gerettete und möglicherweise Traumatisierte zugleich zu sein. Mit ihrer kulturpsychologischen Studie öffnet die Autorin den eindimensionalen Blick auf Traumata als innerpsychische Verletzungen und verortet sie an der Schnittstelle zwischen subjektivem Erleben und gesellschaftlichem Kontext. [ mehr ]
Sozialpsychologie des Autoritären
Um das Erstarken autoritärer Bewegungen und die Wahlerfolge autoritärer Parteien besser verstehen und einschätzen zu können, ist ein detaillierter und differenzierter Blick auf die Autoritarismusforschung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung notwendig. Vor dem Hintergrund von Diskussionen über die Ursachen aktueller autoritärer Dynamiken und über neue Ausformungen des Autoritarismus legt Markus Brunner eine detaillierte und systematische Darstellung der vielfältigen Autoritarismusforschung der Frankfurter Schule vor. [ mehr ]