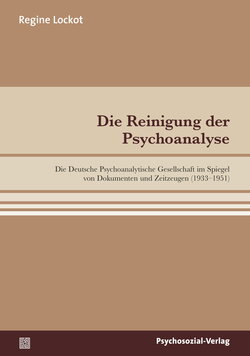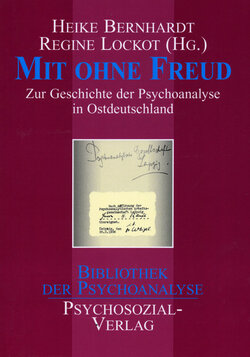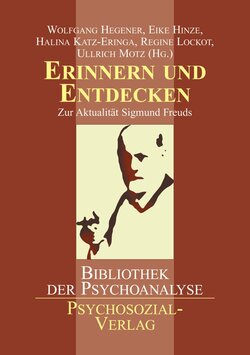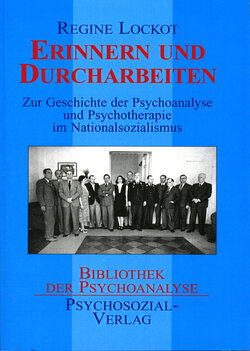Dr. phil., Dipl.-Psych. Regine Lockot
∗

Regine Lockot ist Psychoanalytikerin (DPG, DGPT, IPA). Sie forscht und veröffentlicht zur Geschichte der Psychoanalyse im Nationalsozialismus, in der Nachkriegszeit und in Ostdeutschland. Sie initiierte das Gedenktafelprojekt »Mit Freud in Berlin« und befasst sich zurzeit mit der Beziehungsgeschichte psychoanalytischer Fachgesellschaften (DPG, DPV, DGPT).
Stand: März 2013
Bücher
Die Reinigung der Psychoanalyse
Regine Lockot rekonstruiert die Geschichte der Psychoanalyse im (post-)nationalsozialistischen Kontext und eruiert vergessene Fragmente und Quellen, die als Teile einer kollektiven Amnesie Ausdruck eines institutionellen Verarbeitungsprozesses sind.
Mit ohne Freud
Erinnern und Entdecken
Aus Anlass des 150. Geburtstages von Sigmund Freud fanden in Berlin zahlreiche Veranstaltungen statt. Die hier veröffentlichten Beiträge unterschiedlicher Disziplinen (Neuro-, Kultur-, Literaturwissenschaft, Philosophie und Psychiatrie) wollen an seine historische Leistung erinnern, aber auch das lebendige Potential der Psychoanalyse aufzeigen.
Erinnern und Durcharbeiten
Als erste dokumentenorientierte Gesamtdarstellung der Geschichte der Psychoanalyse ist das Buch inzwischen selbst ein Stück Rezeptionsgeschichte der Geschichte der Psychoanalyse und Psychotherapie in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft geworden. »Erinnern und Durcharbeiten« entstand, um die abgegriffenefn Mythen von »Liquidierung« und »Rettung« der Psychoanalyse als solche zu erkennen und an ihre Stelle heilsame Verwirrung durch genaue Rekonstruktion der Geschichte, narzisstische Kränkung durch die Konfrontation mit der bösen und banalen NS-Alltagswelt zu setzen und vor allem, um Zweifel an der Qualität der Aufbauarbeit der Nachkriegsjahre zu schüren. Mit dieser dekonstruktiven Konstruktivität meint die Autorin dem Geist der Psychoanalyse, auf ihre eigene Profession angewandt, am ehesten gerecht zu werden.