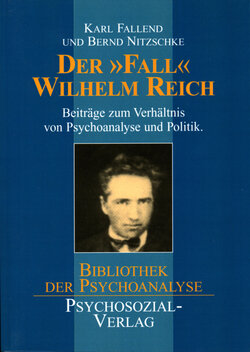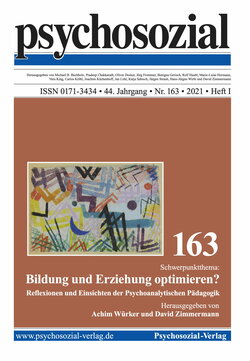Dr. phil., Dipl. Psych. Bernd Nitzschke
∗
Bernd Nitzschke ist Lehranalytiker, Supervisor und Dozent am Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Düsseldorf e.V.
Er hat in Erlangen, München und Marburg Psychologie, Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaften studiert. Während und nach dem Studium war er als Wissenschaftspublizist u. a. für DIE ZEIT sowie als Lektor tätig in den Verlagen Christian Wegner (1970 Lektor), Rowohlt (1971–73 verantwortlicher Redakteur der Reihe »rororo-sexologie«) und Kindler (1978–79 redaktionelle Betreuung der Enzyklopädie »Die Psychologie des 20. Jahrhunderts«). Von 1979–87 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Klinischen Institut für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Seit 1988 ist er in Düsseldorf in eigener Praxis niedergelassen.
Nitzschke ist Mitbegründer des Periodikums »Luzifer-Amor – Zeitschrift für die Geschichte der Psychoanalyse«, Mitherausgeber der »Zeitschrift Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung« sowie Redaktionsmitglied des Periodikums »Werkblatt – Zeitschrift für Psychoanalyse und Gesellschaftskritik«.
Veröffentlichungen u.a.:
Die reale Innenwelt. Anmerkungen zur psychischen Realität bei Freud und Schopenhauer. München (Kindler) 1978.
Der eigene und der fremde Körper. Bruchstücke einer psychoanalytischen Gefühls- und Beziehungstheorie. Tübingen (Konkursbuch Verlag) 1985.
Wir und der Tod. Essays über Sigmund Freuds Leben und Werk. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996.
Aufbruch nach Inner-Afrika. Essays über Sigmund Freud und die Wurzeln der Psychoanalyse. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1998.
Das Ich als Experiment. Essays über Sigmund Freud und die Psychoanalyse im 20. Jahrhundert. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2000.
Kastrationsangst und phallischer Triumph. Anmerkungen zu Sigmund Freuds Männlichkeitskonstruktion. In: Arx, S. von/Gisin, S./Grosz-Ganzoni, I./Leuzinger, M. & Sidler, A. (Hrsg.): Koordinaten der Männlichkeit. Orientierungsversuche. Tübingen (edition diskord) 2003, S. 49–66.
Das magische Dreieck – Otto Gross, C.G. Jung, Sabina Spielrein. Ein Bericht aus der Frühgeschichte der Psychoanalyse. In: Goetz von Olenhusen, A. & Heuer, G. (Hrsg.): Die Gesetze des Vaters. 4. Internationaler Otto Groß Kongreß – Robert-Stolz-Museum – Karl-Franzens-Universität Graz, 24.–26. Oktober 2003. Marburg (LiteraturWissenschaft.de) 2005, S. 210–222.
Wie »es« vor und nach Freud mit dem »Es« so zuging. Forum der Psychoanalyse 2006, 22, S. 315–320.
(Hrsg.) Zu Fuß durch den Kopf - Wanderungen im Gedankengebirge. Ausgewählte Schriften Herbert Silberers – Miszellen zu seinem Leben und Werk. Tübingen (edition diskord) 1988.
(Hrsg.) Freud und die akademische Psychologie. Beiträge zu einer historischen Kontroverse. München (Psychologie Verlags Union) 1989.
Bücher
Der »Fall« Wilhelm Reich
Noch nicht 30-jährig war Wilhelm Reich Leiter des »Technischen Seminars« der »Wiener Psychoanalytischen Vereinigung« geworden. Freud hatte in ihm zunächst einen seiner begabtesten Schüler gesehen, bevor er sich, nachdem Reich Psychoanalyse und Marxismus zu verbinden versucht hatte, zunehmend von ihm distanzierte.
1934 wurde Reich aus der »Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung« ausgeschlossen. Die Hintergründe dieses für die Geschichte der Psychoanalyse in Hitler-Deutschland bedeutsamen Ereignisses werden anhand unbekannter Dokumente rekonstruiert, die bis heute andauernden Folgen analysiert. Gleichsam wird Reichs sexualpolitisches und körpertherapeutisches Erbe einer kritischen Würdigung unterzogen.
Zeitschriften
psychosozial 163: Bildung und Erziehung optimieren? Reflexionen und Einsichten der Psychoanalytischen Pädagogik
Der aktuell populäre Optimierungsimperativ trifft in pädagogischen Praxisfeldern sowohl auf berufsspezifische Selbstansprüche der Professionellen als auch auf strukturell verankerte Verhinderung von Reflexionskulturen. Dies führt zu speziellen Konfliktlagen und subjektiven Abwehrdynamiken.
Die Beiträge loten dieses Konfliktpanorama in der Perspektive einer psychoanalytischen Pädagogik aus. Dabei geht es den Autorinnen und Autoren nicht um eine distanziert-erklärende Diagnose von Defiziten, sondern um die an psychoanalytischer Hermeneutik orientierte Aufdeckung und Deutung szenischer Strukturen, wie sie konkrete pädagogische Interaktionszusammenhänge prägen.