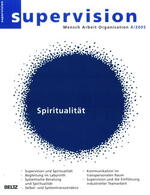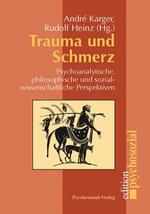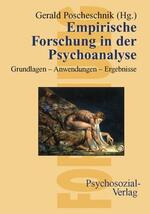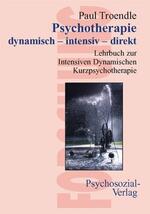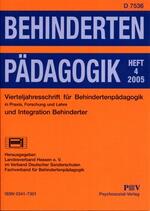Migration aus psychoanalytischer Sicht (PDF)
Formen der Gegenübertragung bei der Beendigung der analytische Behandlung schwergestörter Patienten. Anmerkungen zu Antonino Ferros »Faktoren der Heilung und die Beendigung der
Faktoren der Heilung und die Beendigung der Analyse (PDF)
Zur Darstellung von Psychoanalytikern im Kino. Von Pabsts »Geheimnissen einer Seele« über Hitchcock, Allen, Redford und Moretti bis zu Siegels »Empathy« (PDF)
Verstellte Geschichte. Gebrauchsweisen von Bildern zum Nationalsozialismus (PDF)
Kinogeschichten oder: Die Wirklichkeit auf medialen Irrwegen (PDF)
Narrative Sabotage as a Tactic in the Arena of Collective Memory: An Alternative Logic of Documentation in Eyal Sivan's »The Specialist« (PDF)
Ein Plädoyer für Kitsch statt Grandiosität. »Babij Jar« von Jeff Kanew (PDF)
Einstellung - Darstellung - Vorstellung. Zu Claude Lanzmanns filmischer Repräsentation von Auschwitz (PDF)
Trauma und Schmerz (PDF)
Endlich ein Werk, das die Auseinandersetzung mit der individuellen und kulturellen Dimension von Trauma und Schmerz aus den unterschiedlichen Perspektiven der Psychoanalyse, der Philosophie und der Sozialwissenschaften mit einem interdisziplinären Ansatz betrachtet. [ mehr ]
Männlichkeit und Macht (PDF)
Wie stehen die sozialpädagogischen Profis in der Arbeit mit auch gewaltbereiten männlichen Jugendlichen selber zu den Themen Männlichkeit, Autorität und Macht? Matthias Rudlof hat männliche Jugendsozialarbeiter befragt und ihre Antworten in Bezug auf eine kreative Weiterentwicklung von Männlichkeitstheorien untersucht. [ mehr ]
Empirische Forschung in der Psychoanalyse (PDF)
Der Sammelband leistet einen Beitrag zur Entwicklung einer psychoanalytischen Forschungskultur auf breiter Basis und ist damit wegweisend für die aktuellen Forschungstendenzen.
Mit Beiträgen von: Brigitte Boothe, Peter Fonagy, Ulrich Streek, Siegfried Zepf u. a. [ mehr ]
Psychotherapie dynamisch - intensiv - direkt (PDF)
Das Lehrbuch ist eine systematische, umfassende Einführung in die Theorie und Technik der Intensiven Dynamischen Kurzpsychotherapie und deren aktive und beziehungsbezogene Interventionstechnik. Theoretische Ausführungen, Vignetten und Abbildungen erläutern praxisnah die Kasuistik. [ mehr ]
Papst Innozenz III., das IV. Lateranum und die Strafverfahren gegen Kleriker
Dieses Buch legt erstmals eine umfassende Darstellung der Entwicklung aller kirchlichen (Straf-)Verfahren gegen Kleriker in der kurialen Rechtsprechung unter Papst Innozenz III. vor. Dafür wurde auf den gesamten uns über die päpstlichen Register heute zugänglichen Quellenbestand zurückgegriffen.
Anliegen der Untersuchung ist es, die gängigen Ansichten zur Genese der kirchlichen Verfahrensarten, allem voran des Inquisitions-, Denunciations- ... [ mehr ]
Edward Bibring Photographs the Psychoanalysts of his Time, 1932-1938
This exquisite collection of photographs is the first to assemble rare and personal pictures of psychoanalytic pioneers: Anna Freud, Melanie Klein, Marie Bonaparte, Paul Federn, Michael Balint, Sándor Ferenczi, Otto Fenichel and many others – taken between 1932 and 1938 by Edward Bibring, a close colleague of Sigmund Freud.
Edward Bibring (1894–1959) belonged to the small group of Viennese analysts who worked closely together with Freud after World War I. ... [ mehr ]
Behindertenpädagogik - Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik und Integration Behinderter in Praxis, Forschung und Lehre
Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift »Behindertenpädagogik« befasst sich mit behindertenpädagogischen Problemen der Erziehung und Bildung und des Unterrichts an Vorschulen, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen und Fachhochschulen sowie in der Erwachsenenbildung. Sie wird vom Landesverband Hessen e.V. im Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behindertenpädagogik herausgegeben. ... [ mehr ]
Psychoanalyse im Widerspruch Nr. 34: Shoah-Filme und Gedächtnis
Trauma und Schmerz
Endlich ein Werk, das die Auseinandersetzung mit der individuellen und kulturellen Dimension von Trauma und Schmerz aus den unterschiedlichen Perspektiven der Psychoanalyse, der Philosophie und der Sozialwissenschaften mit einem interdisziplinären Ansatz betrachtet. [ mehr ]