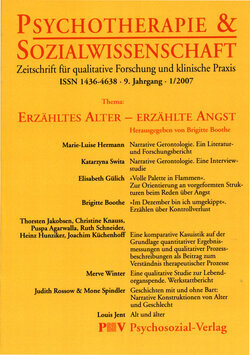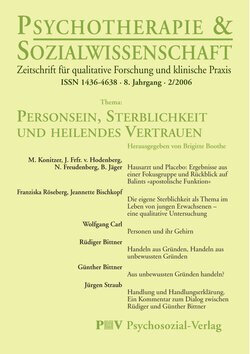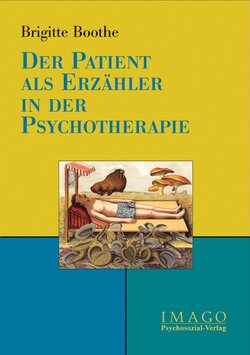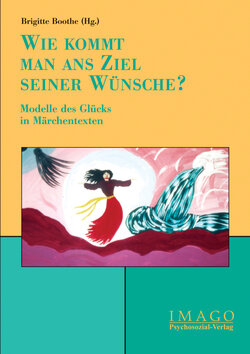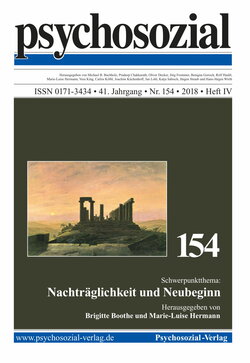Prof. Dr. phil. Brigitte Boothe
∗
Brigitte Boothe ist Psychoanalytikerin (DGPT, DPG), Psychotherapeutin (FSP) und Lehrstuhlinhaberin für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse an der Universität Zürich. Wichtige Veröffentlichungen zur Psychoanalyse der frühen weiblichen Entwicklung und zu Modellen des Glücks in Märchentexten. Zurzeit beschäftigt sie sich vor allem mit den Bereichen Klinische Narrativik und qualitative Methoden, Literatur- und Textanalyse, Lebensrückblick- und Interviewforschung, Kooperations-,Vertrauensbildung und Kreditierung. Sie ist u.a. am Forschungsmodul des Schweizerischen Nationalfonds »Körper und Geschlecht: Normierungsprozesse im Spannungsfeld von Heilung und Verletzung« (Pro Doc), verbunden mit dem Graduiertenkolleg Gender Scripts and Prescripts (Universitäten Basel – Bern – Zürich) beteiligt.
Boothe ist Mitglied in diversen psychoanalytischen, psychotherapeutischen und internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen: Society for Psychotherapy Research (SPR), Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Deutsche psychoanalytische Gesellschaft (DPG), Föderation Schweizerischer PsychologInnen (FSP), Europäische Föderation Psychoanalytischer Psychotherapie (EFPP).
Veröffentlichungen u.a.:
Boothe, B. (2006): Die Religionskritik Freuds und die Überschreitung des Gegebenen. In I. U. Dalferth & H.-P. Grosshans (Hrsg.): Kritik der Religion. Tübingen (Mohr/Siebeck), S.163–186.
Boothe, B. (2006): Abraham, der Ausgezeichnete. Die Loyalitätsprobe. Handlung Kultur Interpretation. Zeitschrift für Sozial- und Kulturwissenschaften 15, 274–304.
Luif, V./Thoma, G. & B. Boothe (Hrsg.) (2005): Beschreiben – Erschliessen – Erläutern. Psychotherapieforschung als qualitative Wissenschaft. Berlin (Pabst).
Boothe, B. & P. Stoellger (Hrsg.) (2004): Moral als Gift oder Gabe? Zur Ambivalenz von Moral und Religion. 1. Band der wissenschaftlichen Buchreihe Interpretation Interdisziplinär, herausgegeben von Brigitte Boothe & Philipp Stoellger. Würzburg (Königshausen & Neumann).
Boothe, B. & Ugolini, B. (Hrsg.) (2003): Lebenshorizont Alter. Zürich (vdf).
Bücher
Psychotherapie & Sozialwissenschaft 1/2009: Jubiläumsheft
Psychotherapie & Sozialwissenschaft 1/2007: Erzähltes Alter - erzählte Angst
Die Zeitschrift erschien von 2005 bis 2013 im Psychosozial-Verlag. Im Jahr 2014 hat sich die Zeitschrift »psychosozial« mit der Zeitschrift »Psychotherapie und Sozialwissenschaft« zusammengeschlossen und erscheint weiter unter dem Namen »psychosozial«.
Der Patient als Erzähler in der Psychotherapie
Erzählen schafft Spannung – Erzählen löst Spannung. Wie das geschieht, lehrt die klinische Erzählanalyse. Sie erschließt das kommunikative und das psychodynamische Potential der mündlichen Alltagserzählung in der Psychotherapie.
»Wie kommt man ans Ziel seiner Wünsche?«
Im Märchen gestaltet sich ein Kräftespiel zwischen Lebensanspruch und Glücksverlangen. Das Glücksverlangen siegt. Nicht als Illusion und nicht als moralische Prämie. Das Glücksverlangen siegt, weil die Gefahren, die drohen, und die Aussichten, die winken, einer konsequenten Logik des Gelingens folgen. Diese Logik des Gelingens kennenzulernen, ist nicht nur für Märchenleser und Märchenerzähler aufschlussreich, sondern auch für Eltern, Erzieher, Berater und Psychotherapeuten, für Entwicklungspsychologen, Psychoanalytiker und Literaturwissenschaftler.
Zeitschriften
psychosozial 175: Menschenbilder in Psychologie und Psychoanalyse
Die Frage nach dem Wesen des Menschen ist ein zentrales Thema in den Humanwissenschaften. Sie wird von der Philosophie bis zu den Naturwissenschaften diskutiert und spielt auch in der Psychologie und Psychoanalyse eine bedeutende Rolle. Der Themenschwerpunkt dieses Hefts stellt eine eingehende Analyse für die Psychologie relevanter anthropologischer Modelle in den Mittelpunkt.
psychosozial 154: Nachträglichkeit und Neubeginn
Seit der Prägung des Wortes durch Freud scheint die Idee der Nachträglichkeit zwar zentral, doch unterbestimmt zu sein. Das Anliegen dieser Ausgabe ist es daher, die Perspektive zu öffnen und zu weiten – hin zu einer Kultur des Umgangs mit Nachträglichkeit und Neubeginn. Nachträglichkeit ist Wiederaufnahme: Vielfältige und -schichtige biografische Eindrucksbildungen werden in zeitlicher Distanz unbewusst wieder aufgenommen und entfalten positive oder negative Wirkung. Die Kultur des Erinnerns im öffentlichen wie im persönlichen Raum hat sich heutzutage als etwas gesellschaftlich Essenzielles etabliert. Sie sollte auch ein tragendes Element in Psychotherapie und Psychoanalyse sein.