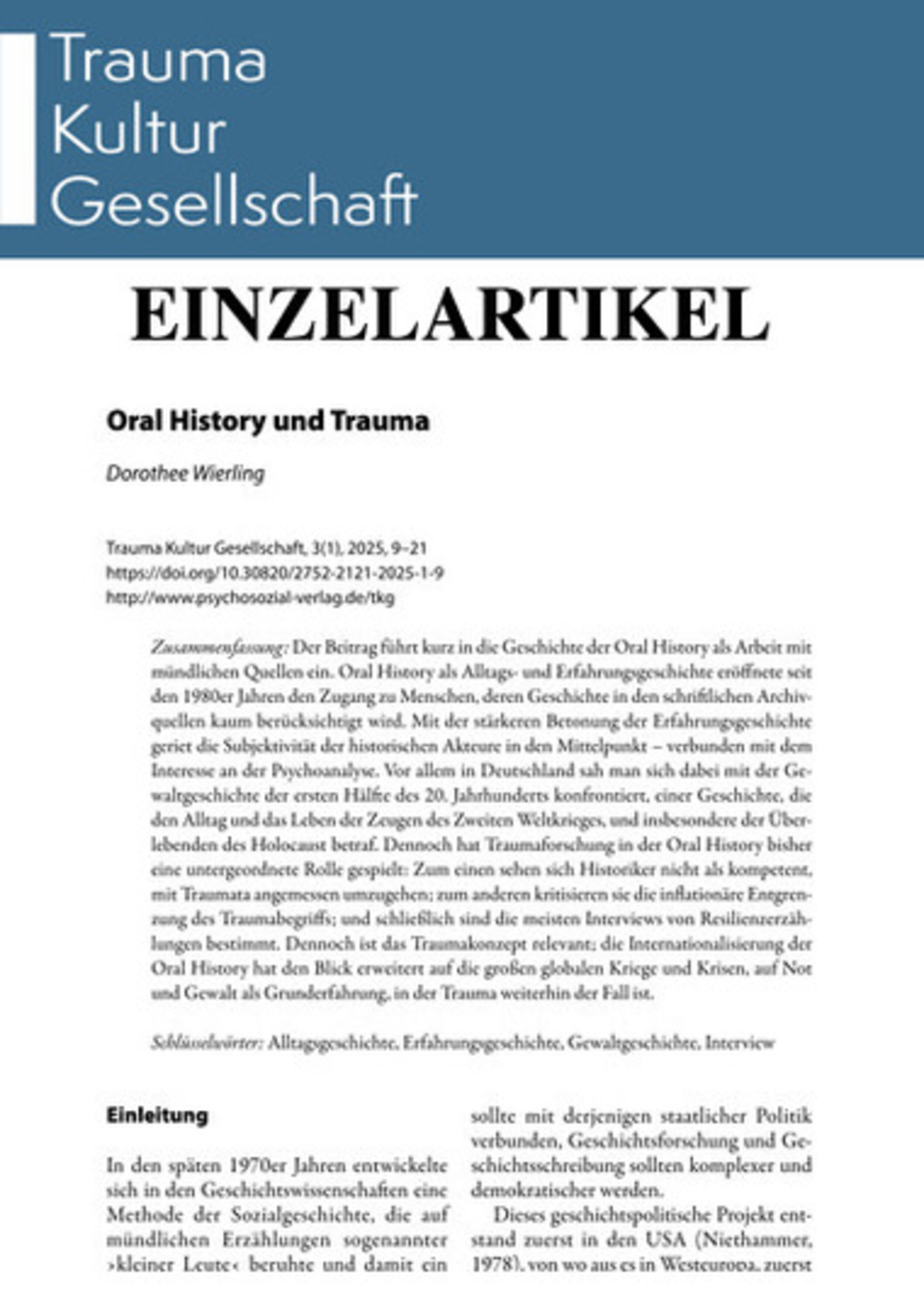13 Seiten, PDF-E-Book
Erschienen: März 2025
Bestell-Nr.: 36556
https://doi.org/10.30820/2752-2121-2025-1-9
abonnieren
Dorothee Wierling
Oral History und Trauma (PDF)
Sofortdownload
Dies ist ein E-Book. Unsere E-Books sind mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen,
jedoch frei von weiteren technischen Schutzmaßnahmen (»DRM«).
Erfahren Sie hier mehr zu den Datei-Formaten.
Der Beitrag führt kurz in die Geschichte der Oral History als Arbeit mit mündlichen Quellen ein. Oral History als Alltagsund Erfahrungsgeschichte eröffnete seit den 1980er Jahren den Zugang zu Menschen, deren Geschichte in den schriftlichen Archivquellen kaum berücksichtigt wird. Mit der stärkeren Betonung der Erfahrungsgeschichte geriet die Subjektivität der historischen Akteure in den Mittelpunkt – verbunden mit dem Interesse an der Psychoanalyse. Vor allem in Deutschland sah man sich dabei mit der Gewaltgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konfrontiert, einer Geschichte, die den Alltag und das Leben der Zeugen des Zweiten Weltkrieges, und insbesondere der Überlebenden des Holocaust betraf. Dennoch hat Traumaforschung in der Oral History bisher eine untergeordnete Rolle gespielt: Zum einen sehen sich Historiker nicht als kompetent, mit Traumata angemessen umzugehen; zum anderen kritisieren sie die inflationäre Entgrenzung des Traumabegriffs; und schließlich sind die meisten Interviews von Resilienzerzählungen bestimmt. Dennoch ist das Traumakonzept relevant; die Internationalisierung der Oral History hat den Blick erweitert auf die großen globalen Kriege und Krisen, auf Not und Gewalt als Grunderfahrung, in der Trauma weiterhin der Fall ist.
Abstract:
The article briefly introduces the history of oral history as a historiographical method. Since the 1980s, oral history of everyday life and experience has given access to ordinary people’s stories which had been dismissed in traditional archival sources. With the greater emphasis on the history of experience, the subjectivity of the historical actors came into focus – combined with a growing interest in psychoanalysis. In Germany in particular, historians were confronted with the history of extreme violence during the first half of the 20th century, a history that affected the everyday lives during the Second World War, and in particular those of Holocaust survivors. However, trauma research had so far played a subordinate role in Oral History: on the one hand, historians feel their lack of competence to appropriately deal with trauma; on the other hand, they criticize the inflationary blurring of boundaries when it comes to trauma; and finally, most interviews are dominated by narratives of resilience. Nevertheless, the concept of trauma remains relevant. The internationalization of oral history has broadened the view towards major global wars and crises, hardship and violence as a basic human experience, and therefore for the ongoing presence of trauma.
Abstract:
The article briefly introduces the history of oral history as a historiographical method. Since the 1980s, oral history of everyday life and experience has given access to ordinary people’s stories which had been dismissed in traditional archival sources. With the greater emphasis on the history of experience, the subjectivity of the historical actors came into focus – combined with a growing interest in psychoanalysis. In Germany in particular, historians were confronted with the history of extreme violence during the first half of the 20th century, a history that affected the everyday lives during the Second World War, and in particular those of Holocaust survivors. However, trauma research had so far played a subordinate role in Oral History: on the one hand, historians feel their lack of competence to appropriately deal with trauma; on the other hand, they criticize the inflationary blurring of boundaries when it comes to trauma; and finally, most interviews are dominated by narratives of resilience. Nevertheless, the concept of trauma remains relevant. The internationalization of oral history has broadened the view towards major global wars and crises, hardship and violence as a basic human experience, and therefore for the ongoing presence of trauma.
Andreas Hamburger & Dorothee Wierling S. 5–7Editorial (PDF)
Trauma und Oral HistoryDorothee WierlingS. 9–21Oral History und Trauma (PDF)
Andreas HamburgerS. 23–35Soziales Trauma und reflexive Zeugenschaft (PDF)
Psychoanalytische Gedanken zur Oral HistoryAndreas Hamburger, Agnès Arp & Jörg Frommer S. 37–50Oral History und psychoanalytische Forschung zu Vergangenheit und Gegenwart der DDR (PDF)
Anna-Sophia ClemensS. 51–66Geschichten von Widerstand und Verfolgung in Interaktion - oder wie wir zu Subjekten werden (PDF)
Ein Bericht aus der psychoanalytischen Forschung zur transgenerationalen Weitergabe von Verfolgung und Widerstand im sozialhistorischen Kontext der BRD nach 1945Gelinada GrinchenkoS. 67–73Involviert sein: Produktion eines Oral-History-Films über den Zweiten Weltkrieg inmitten der russischen Aggression gegen die Ukraine (PDF)
Natalia Khanenko-FriesenS. 75–80Ein ›verzögertes Zeugnis‹ (PDF)
Form und Bedeutung der Holodomor-Erzählung in einem Videointerview mit Pavlo NazarenkoSonja KnoppS. 81–85Das Überlebendenzeugnis als historische Quelle (PDF)
Ein VermittlungsversuchAlmut Rudolf-Petersen, Helene Timmermann, Ilse Höcker & Gabriele Amelung S. 87–94Kinder des Widerstands (PDF)
Ein ForschungsberichtMichail Gruev, Evelina Kelbecheva & Diana Mishkova S. 95–100Das Trauma kartieren (PDF)
Kommunistische Verfolgung in Bulgarien
Trauma und Oral HistoryDorothee WierlingS. 9–21Oral History und Trauma (PDF)
Andreas HamburgerS. 23–35Soziales Trauma und reflexive Zeugenschaft (PDF)
Psychoanalytische Gedanken zur Oral HistoryAndreas Hamburger, Agnès Arp & Jörg Frommer S. 37–50Oral History und psychoanalytische Forschung zu Vergangenheit und Gegenwart der DDR (PDF)
Anna-Sophia ClemensS. 51–66Geschichten von Widerstand und Verfolgung in Interaktion - oder wie wir zu Subjekten werden (PDF)
Ein Bericht aus der psychoanalytischen Forschung zur transgenerationalen Weitergabe von Verfolgung und Widerstand im sozialhistorischen Kontext der BRD nach 1945Gelinada GrinchenkoS. 67–73Involviert sein: Produktion eines Oral-History-Films über den Zweiten Weltkrieg inmitten der russischen Aggression gegen die Ukraine (PDF)
Natalia Khanenko-FriesenS. 75–80Ein ›verzögertes Zeugnis‹ (PDF)
Form und Bedeutung der Holodomor-Erzählung in einem Videointerview mit Pavlo NazarenkoSonja KnoppS. 81–85Das Überlebendenzeugnis als historische Quelle (PDF)
Ein VermittlungsversuchAlmut Rudolf-Petersen, Helene Timmermann, Ilse Höcker & Gabriele Amelung S. 87–94Kinder des Widerstands (PDF)
Ein ForschungsberichtMichail Gruev, Evelina Kelbecheva & Diana Mishkova S. 95–100Das Trauma kartieren (PDF)
Kommunistische Verfolgung in Bulgarien