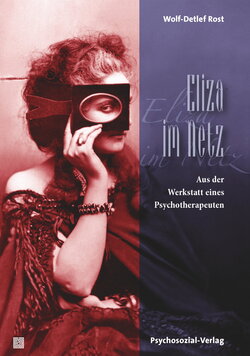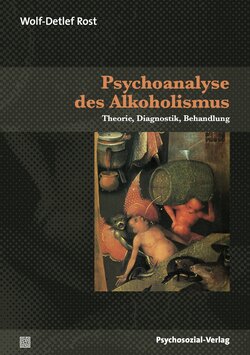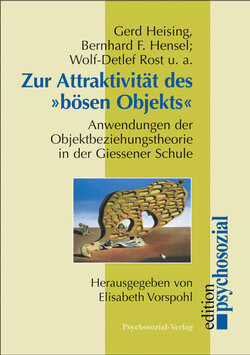Dr. phil., Dipl.-Psych. Wolf-Detlef Rost
∗

Wolf-Detlef Rost ist nach seiner Tätigkeit an der Psychosomatischen Universitätsklinik Gießen, einer Fachklinik für Alkohol- und Medikamentenabhängige und dem Institut für Psychoanalyse an der Universität Frankfurt am Main seit 1986 in freier Praxis als Psychoanalytiker und Supervisor tätig. Schwerpunkt: Abhängigkeitserkrankungen. Diverse Zeitschriften- und Buchbeiträge zur Theorie und Therapie der Sucht.
Bücher
Eliza im Netz
Als lebendige und spannende Fallschilderung aus der Perspektive des Patienten und in literarischer Form stellt das Buch einen neuen, im deutschen Sprachraum außergewöhnlichen Zugang zur Psychoanalyse dar.
Psychoanalyse des Alkoholismus
Der Autor will das Verständnis für die Psychodynamik hinter der Sucht fördern und sieht den Alkoholismus als Symptom einer tiefer liegenden Störung. Ausgehend von der psychoanalytischen Theorie werden dazu unterschiedliche Formen von Alkoholabhängigkeit diagnostisch erfasst und an zahlreichen Fallbeispielen erläutert.
Zur Attraktivität des »bösen Objekts«
Dieser Band versammelt bisher nicht publizierte und wenig verbreitete Aufsätze des in Fachkreisen bekannten Gießener Psychoanalytikers Gerd Heising und seiner Schüler. Schwerpunkt der bis in die sechziger Jahre zurückreichenden Arbeiten ist die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie und ihre Anwendung in unterschiedlichen Praxisfeldern.
Zeitschriften
psychosozial 170: Indien-Bilder
Mit dem britischen Kolonialismus und Imperialismus kam seit dem 18. Jahrhundert neben Persien und China vor allem Indien, dem »Juwel in der britischen Krone«, eine zentrale, auch psychologische Rolle in der Entwicklung eines breiteren europäischen Selbstverständnisses zu. Waren einige prominente Gelehrte fasziniert von vermeintlichen linguistischen, mythologischen und philosophischen Verwandtschaften zwischen Europa und Indien, so waren viele Missionare und Politiker vor allem bemüht, die europäische Herrschaft über den indischen Subkontinent und seine riesige Bevölkerung durch Strategien der Infragestellung und pauschalen Abwertung indischer Kulturleistungen zu legitimieren. Wie die einzelnen Beiträge illustrieren, zeigen sich in der Auseinandersetzung mit dem, was den einen verwandt und vertraut, den anderen fremd und abartig erscheint, neben Brüchen auch Kontinuitäten, deren Untersuchung von interdisziplinärer aber auch psychosozialer Relevanz ist.