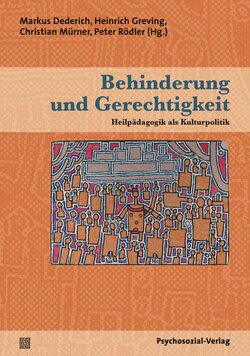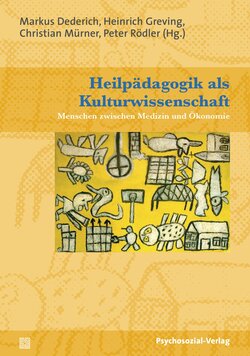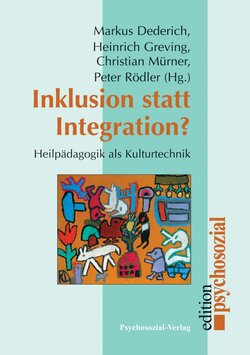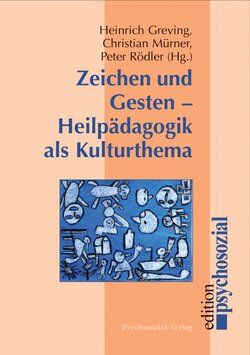Prof. i.R. Dr. Peter Rödler
∗

Peter Rödler war bis 2018 Professor für Allgemeine Didaktik mit dem Schwerpunkt Heterogenität an der Universität Koblenz-Landau. Er war damit der bisher einzige ausgewiesene Sonderpädagoge auf einem Lehrstuhl für allgemeine Lehrerbildung. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte liegen im Bereich der Lehrerbildung, der Allgemeinen Pädagogik und der Computervisualistik mit den Schwerpunkten anthropologische, erkenntnistheoretische und methodische Grundlagen einer Allgemeinen Pädagogik und Sprache als relationaler, bio-semiotischer Kulturraum.
Rödler wurde 1993 für Erziehungswissenschaften habilitiert auf der Basis der Habilitationschrift Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen – Grundlagen einer allgemeinen basalen Pädagogik. In den folgenden Jahren hatte er Gastprofessuren an den Universitäten Frankfurt, Würzburg, Wien und Innsbruck inne.
Zusammen mit Prof. Gerd Schwabe (Wirtschaftsinformatik) und Prof. Uli Fuhrbach (Informatik, KI) gründete er 2001 das fachbereichübergreifende Dienstleistungs- und Forschungsinstitut »Institut für Wissensmedien« (IWM) und war bis war bis 2018 Mitdirektor des Instituts.
Er war Mitglied in den EU-Sokrates-Projekten INTEGER zur Erarbeitung eines Hochschulcurriculums für Inclusive Education und ODL:Inclusive zur Erarbeitung eines Selbst- und Fernstudienmoduls zu den Grundlagen von Inclusive Education.
Für das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung (zfuw) der Uni Koblenz-Landau organisierte er den Fernstudien Master »Inklusion und Schule«, der 2016 das erste Mal angeboten wurde.
Rödler hält Vorträge und macht Fall- und Krisenberatungen insbesondere zu autistischem Verhalten und den Grundlagen der Arbeit mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen im In- und Ausland, unter anderem in Ecuador, Italien, Japan, Österreich und Ungarn.
Von 1989 bis 2007 war er Schriftleiter der Fachzeitschrift Behindertenpädagogik.
(Stand: April 2020)
Veröffentlichungen u.a.:
geistig behindert – Menschen, lebenslang auf Hilfe anderer angewiesen? Neuwied, Berlin 2000.
Diagnose: Autismus – ein Problem der Sonderpädagogik. Frankfurt am Main, Afra-Druck, 1983.
Rödler, P./Berger, E./Jantzen, W. (Hrsg.): Es gibt keinen Rest! Neuwied, Berlin 2001.
mit Greving H. (Hrsg.): Stichworte »Sprache«, »Kommunikation« und »Autismus«. In: Kompendium Heilpädagogik. Bildungsverlag eins, Troisdorf 2007.
Pubertät als krisenanfällige Zeit. In: Hilfe für das autistische Kind e.V.: Krise ist immer auch Bewegung - Autismus im Brennpunkt. Hamburg 2005.
Rehistorisierung als Konstruktion. In: Feuser, G./Jantzen, W.: Erkennen und Handeln. Berlin 2002.
Die Theorie des Sprachraums als methodische Grundlage der Arbeit mit ›schwerstbeein- trächtigten‹ Menschen. In: Rödler, P./Berger, E./Jantzen, W.: Es gibt keinen Rest! Neuwied, Berlin 2001.
Geistig behindert – nicht wahr aber wirklich! In: Greving/Gröschke (Hrsg.): Geistige Behinderung - Reflexionen über ein Phantom. Bad Heilbrunn 2000.
Ein wahrer Einblick in eine unheimliche Inklusionsdiskussion. Behindertenpädagogik 4/2011, S. 342–355.
Kein Missverständnis! Zur tödlichen Logik der Argumentation Peter Singers. Behindertenpädagogik 1/2011, S. 54–65.
Bücher
Behinderung und Gerechtigkeit
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das begriffliche Dreieck Gerechtigkeit, Politik und Kultur, das in Hinblick auf die Heilpädagogik als gesellschaftlich institutionalisierter Disziplin und Profession untersucht wird.
Heilpädagogik als Kulturwissenschaft
In diesem Band werden wichtige Aspekte der heutigen Ökonomie und Medizin aus der Perspektive ihrer Wirkung auf ein inklusives Menschenbild kritisch diskutiert.
Inklusion statt Integration?
Seit einigen Jahren zeichnet sich in der Fachdiskussion zur Behindertenpädagogik die Tendenz ab, den Begriff der Integration durch den der Inklusion zu ersetzen. Was macht den Erfolg dieses Begriffes aus? Der Band bearbeitet »Inklusion« in dreierlei Weise: Mit sozial- und bildungspolitischer Perspektive, die Relevanz des Diskurses in praktischer Hinsicht und mit dem Fokus auf thematische Schwerpunkte wie Biomedizin und Menschenrechte.
Zeichen und Gesten - Heilpädagogik als Kulturthema
Sprachliche Zeichen und körperliche Gesten sind grundlegend für die menschliche Kultur und den Umgang mit Menschen. Darauf aufbauend, beschreiben die Beiträger dieses Bandes den Wandel von Zeichen und Gesten in der Heilpädagogik und stellen dies als Kulturthema vor.