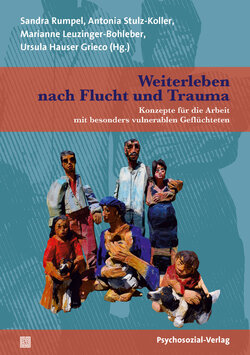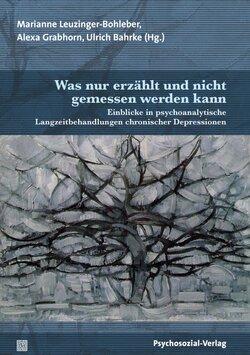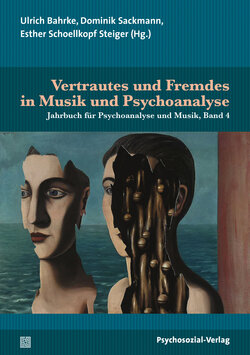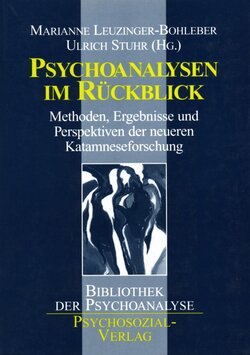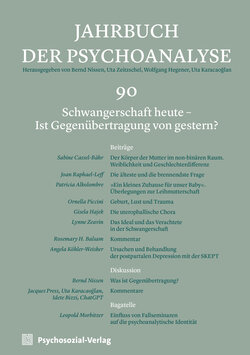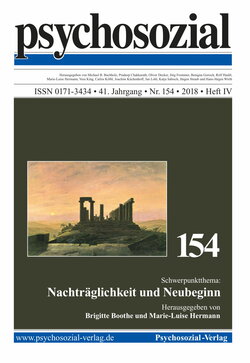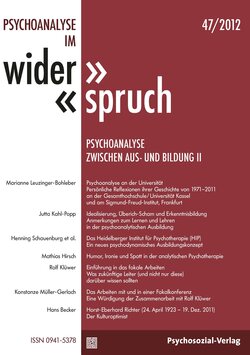Prof. Dr. phil. Marianne Leuzinger-Bohleber
∗

Marianne Leuzinger-Bohleber ist Emerita für Psychoanalyse an der Universität
Kassel. Sie war von 2001 bis 2006 Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts (SFI) in Frankfurt am Main. Nun ist sie Senior Scientist am SFI und an der Universität Mainz sowie Member des Scientific Boards des IDeA Centers in Frankfurt am Main. Weiterhin ist sie Co-Chair for Europe des Research Boards der International Psychoanalytical Association und Mitglied der Action Group der Society for Neuro-Psychoanalysis. Sie erhielt den Mary Sigourney Award 2016 und den Haskell Norman Prize for Excellence in Psychoanalysis 2017. Ihre Arbeitsgebiete sind klinische und empirische Forschung in der Psychoanalyse, Adoleszenz, psychoanalytische Entwicklungspsychologie, Frühprävention, Psychoanalyse und Cognitive Science/Literaturwissenschaften/Wissenschaftstheorie.
Stand: November 2019
Bücher
Weiterleben nach Flucht und Trauma
Die Autor*innen zeigen in einer praxisnahen Darstellung des Modellprojekts aacho, wie bindungs- und entwicklungsorientierte, kultursensible und traumaspezifische therapeutische Herangehensweisen es ermöglichen, den individuellen Bedürfnissen von Geflüchteten zu entsprechen. In einer Kombination aus systemischen und psychodynamischen Perspektiven veranschaulicht das Buch neue Wege für die Arbeit mit besonders vulnerablen Geflüchteten.
Was nur erzählt und nicht gemessen werden kann
Erfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker erzählen anhand von Falldarstellungen von der heilenden Wirkung von Psychoanalysen mit chronisch depressiven Patientinnen und Patienten. Zudem wird auch die LAC-Depressionsstudie vorgestellt – eine vergleichende Therapiewirksamkeitsstudie zu den Kurz- und Langzeiteffekten von psychoanalytischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Langzeittherapie bei chronischer Depression.
Vertrautes und Fremdes in Musik und Psychoanalyse
Die Autorinnen und Autoren denken aus der doppelten Perspektive von Psychoanalyse und Musik über Kompositionen, Inspirationen, Rezeptionshaltungen und Deutungen klanglicher Phänomene nach. Musik wird dabei als die hohe Kunst der Wiederholung betrachtet, die zum Verweilen im Vertrauten einlädt und zugleich zum Ausbruch ins unwägbare Neue reizt.
»Fremd bin ich eingezogen …«
Klinische Erfahrungen und Konzepte aus der psychoanalytischen und interdisziplinären Traumaforschung können auf die Arbeit mit Geflüchteten übertragen werden und helfen, die Wahrscheinlichkeit einer transgenerativen Weitergabe extremer Traumatisierungen zu verringern. Aus dieser Erkenntnis heraus kombinieren die Autorinnen dieses Buchs psychoanalytisch-konzeptuelle Überlegungen mit fundierten und lebhaften Einblicken in die Praxis. Dazu greifen sie auch auf eine reiche Anzahl an Fallbeispielen zurück, die ihrer Arbeit innerhalb des STEP-BY-STEP-Projekts in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung »Michaelisdorf« in Darmstadt entstammen.
Psychoanalysen im Rückblick
Zuerst stellen international renommierte Psychoanalytiker den historischen und aktuellen Kontext der Auseinandersetzungen um eine differenzierte und adäquate Katamneseforschung in der Psychoanalyse dar. Gesundheitspolitische Aspekte, Kontroversen zu Ziel- und Erfolgskriterien sowie Langzeitwirkungen von Behandlungen werden diskutiert. Dies trägt zum besseren Verständnis wesentlicher Zielsetzungen, methodischer Vorgehensweisen sowie vielschichtiger Ergebnisse internationaler Studien in diesem Gebiet bei, die im dritten Teil des Buches vorgestellt werden.
Zeitschriften
Jahrbuch der Psychoanalyse - Band 90
»Schwangerschaft« zeigt eine weitgehende Leerstelle in Freuds Werk an. In der analytischen Behandlung wurde die Schwangerschaft früher oft als Widerstand und Agieren aufgefasst oder galt als ein Zustand, in dem ganz von einer Psychoanalyse abgesehen werden sollte. Auch in der psychoanalytischen Ausbildung und Supervision findet sie bis heute wenig Beachtung. Daher soll sie durch die Beiträge der Autorinnen dieses Bandes einen Denkraum bekommen.
Psychotherapie-Wissenschaft 2/2020: Therapie depressiver Prozesse, hg. von Rosmarie Barwinski und Peter Schulthess
Depressive Erkrankungen nehmen in den letzten Jahren weltweit zu. Die WHO geht davon aus, dass sie im Jahr 2020 die zweithäufigste Erkrankung darstellen. Galten sie bislang als gut behandelbar, zeigt sich nun, dass viele schwere Depressionen chronifizieren können und dass die Anzahl chronifizierter Depressionen steigt. Diese Ausgabe der Psychotherapie-Wissenschaft leuchtet die Thematik vielseitig aus, von aktueller Forschung bis hin zur Darstellung besonderer Ansätze der Therapie. Psychotherapie-Wissenschaft dient auf hohem Niveau der Entwicklung der Psychotherapie. Die darin enthaltenen Beiträge zur Praxis und Forschung fördern den interdisziplinären Austausch.
psychosozial 154: Nachträglichkeit und Neubeginn
Seit der Prägung des Wortes durch Freud scheint die Idee der Nachträglichkeit zwar zentral, doch unterbestimmt zu sein. Das Anliegen dieser Ausgabe ist es daher, die Perspektive zu öffnen und zu weiten – hin zu einer Kultur des Umgangs mit Nachträglichkeit und Neubeginn. Nachträglichkeit ist Wiederaufnahme: Vielfältige und -schichtige biografische Eindrucksbildungen werden in zeitlicher Distanz unbewusst wieder aufgenommen und entfalten positive oder negative Wirkung. Die Kultur des Erinnerns im öffentlichen wie im persönlichen Raum hat sich heutzutage als etwas gesellschaftlich Essenzielles etabliert. Sie sollte auch ein tragendes Element in Psychotherapie und Psychoanalyse sein.
Psychoanalyse im Widerspruch Nr. 47: Psychoanalyse zwischen Aus- und Bildung II