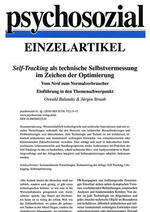psychosozial
Prokrastination - Präkrastination (PDF)
Der erste Teil des Beitrags ist praxisbezogen, der Inhalt leitet sich direkt aus der beruflichen Erfahrung ab. Die Subjektivierung von Arbeit und die von der Gesellschaft weitestgehend akzeptierte Forderung, alle beruflichen Tätigkeiten sofort und ohne Aufschub erledigen zu müssen, führt zu einer Zunahme von Präkrastination im beruflichen Bereich und einer Zunahme von Prokrastination im privaten Bereich. Die Unterscheidung dieser beiden zwanghaften ... [ mehr ]
Intermezzi (PDF)
Der Artikel verknüpft die Zeitlichkeit der Prokrastination mit ästhetischen Aktivitäten und Strategien des Aufschiebens. Prokrastination weist eine starke Verbindung zu Melancholie und Krise auf und beeinflusst wie diese die Beziehung von Objekten und Bedeutungen. Dazu wird von der Beobachtung ausgegangen, dass Ästhetiken der Prokrastination vermehrt im Theater seit 1990 auftreten, und untersucht, wie in den Produktionen von drei KünstlerInnen zu ... [ mehr ]
Prokrastination und die Gunst der Stunde (PDF)
In »Prokrastination und die Gunst der Stunde« nimmt Anja Kauß eine kulturhistorische Ortsbestimmung des Prokrastinationsbegriffs vor. Entgegen gegenwärtiger Auffassungen von Prokrastination als dysfunktionales Aufschieben unangenehmer Aufgaben hebt sie dabei abwägende, strategische und bewegungspolitische Aspekte prokrastinierter Entscheidungen hervor. Dieser Doppelcharakter der Prokrastination kommt in der antiken mythologischen Figur des Kairos auf ... [ mehr ]
Einige systematische Überlegungen zur Grundlegung einer Psychoanalytischen Erziehungs- und Bildungswissenschaft (PDF)
Jener erziehungswissenschaftliche Fachbereich, der als Psychoanalytische Pädagogik tradiert wird und dessen Erkenntnisinteresse vor allem die Reflexion des Interaktionsfelds Pädagoge-Edukand betrifft, vermag den paradigmatischen, gesellschaftstheoretischen und kulturkritischen Stellenwert der Psychoanalyse in den modernen Erziehungsund Bildungswissenschaften nicht ausreichend abzubilden. Um den Fortbestand der Psychoanalyse im Kontext der Bildungswissenschaften ... [ mehr ]
Identität, Fundamentalismus und Medien (PDF)
Der Autor versteht Identität als dynamisches Zusammenspiel von Positivität (Kontinuität, Kohärenz) und Negativität (Entfestigung, Veränderungsoffenheit). In traditionellen Lebenswelten ist Identität durch Positivität dominiert, Kontingenz wird abgewehrt. Umgekehrt findet man in der Spätmoderne Tendenzen zur Affirmation von Kontingenz und Negativität. Insbesondere für Adoleszente mit einem verunsicherten traditionalen ... [ mehr ]
Destruktivität, Gewalt und die Macht der Medien (PDF)
Es ist keine leicht zu bewältigende Aufgabe, mit der Wirklichkeit des Bösen fertig zu werden, das eine Provokation für das Weltverständnis und die Werte darstellt. Die Psychoanalyse ermöglicht es, individuelle und kollektive destruktive Prozesse nachvollziehen zu können. Dabei stellt sich heraus, dass das Böse meist nicht kategorial, sondern dimensional verstanden werden kann. Was als böse erscheint, kann unter Umständen auch ... [ mehr ]
Fundamentalismus und Medien (PDF)
In dem Artikel wird die Rolle der Medien bei der Entwicklung des Fundamentalismus – ob jüdischer, christlicher oder islamischer Art – beschrieben. Ein Rückblick auf die Entstehung des Monotheismus zeigt, wie eng dieser selbst mit dem neu erfundenen alphabetischen Schreibsystem der Antike zusammenhing. Das gilt auch für die modernen Fundamentalismen, die sich zwar auf transzendente Glaubensinhalte berufen, aber ganz im Bann medialer Kommunikation ... [ mehr ]
Selbstvermessung wider Willen (PDF)
Selbstvermessungsgeräte lassen sich als Produkte einer Technikkultur des »Solutionismus« und als Instrumente zur Selbstoptimierung bezeichnen. Anhand einer qualitativen Fallanalyse einer Selbstvermesserin wird gezeigt, dass diese Geräte und die von ihnen produzierten Zahlen für das Selbst eine psychosoziale Funktion erlangen können. Im Rahmen einer Technikkultur, in der Rechenmaschinen mit kollektiven Hoffnungen auf operative Lösungen ... [ mehr ]
Warum nun auch der Schlaf? (PDF)
Der Beitrag widmet sich dem neuen digitalen Service-Typ Schlaf-App, der sich aktuell – augenscheinlich nachfragegetrieben – rasch in Form diverser kostenloser oder kostengünstiger Produkte verbreitet. Was bieten Schlaf-Apps? Wie machen sie sich attraktiv und was motiviert zu deren Nutzung? Dem Beitrag zufolge handelt es sich um spielerische und im Detail auch tatsächlich nutzlose, um völlig sinnfreie Produkte. Ebendeshalb bleibt aber eben die Frage ... [ mehr ]
Rückzug auf den eigenen Körper (PDF)
Der Artikel analysiert den Fokus von Lifelogging-Praktiken auf Gesundheitsund Fitnessanwendungen mithilfe einer verdinglichungstheoretischen Perspektive. Dabei versteht er das Ringen um die Kontrolle über den eigenen Körper als Rückzug der Realisierung der Autonomie von zunehmend unkontrollierbar und unsicher erscheinenden gesellschaftlichen Verhältnissen und Lifelogging als (entfremdeten) Versuch, eine erfahrene Heteronomie zu ... [ mehr ]
Alles, was zählt (PDF)
Der Beitrag rekonstruiert die Vorgeschichte der gegenwärtigen Selbsttrackingund Selbstoptimierungsverfahren. Dazu erweist es sich als sinnvoll, auf eine Sachlage zurückzugreifen, die das Phänomen der Datenverarbeitung als Problem seiner Materialität und seines Umfangs virulent werden lässt. Für den deutschen Sprachraum spitzt sich diese Konstellation am Ende des 18. Jahrhunderts zu – in einem Moment, in dem das Projekt einer Datenverarbeitung ... [ mehr ]
Selbstvermessung als Optimierungsform und Abwehrkorsett (PDF)
Anknüpfend an Befunde aus einem Projekt über »Aporien der Perfektionierung in der beschleunigten Moderne«, in dem Folgen und Paradoxien von zeitgenössischen Optimierungsund Perfektionierungsanforderungen in ihrem Wechselspiel mit individuell biografischen Dispositionen und Motiven untersucht worden sind, wird in diesem Beitrag herausarbeitet, wie sich Logiken des Messens in einer an stetiger Selbstverbesserung ausgerichteten Lebensführung zum ... [ mehr ]
Kalkulative Formen der Selbstthematisierung und das epistemische Selbst (PDF)
Zahlen bieten im Kontext der Individualisierung und Beschleunigung von Lebensverhältnissen spezifische Vorteile gegenüber narrativen Selbstthematisierungen. Selbstvermessungspraktiken werden aufgrund der Objektivitätsfiktion, der universalen Vergleichsfunktion sowie der Stärke schwacher Zahlen als eine Institution der Selbstthematisierung untersucht, die im Vergleich zu Beichte und Gruppentherapie eine spezifisch dynamische Stabilisierung des Selbst ... [ mehr ]
Self-Tracking als technische Selbstvermessung im Zeichen der Optimierung (PDF)
Wissenschaftlich-technologische und technische Innovationen sind mit sozialen Vorstellungen verknüpft, die den Horizont rein technischer Herausforderungen und Problemlösungen weit überschreiten. Jede Technologie und Technik ist mit kollektiven, öffentlich artikulierten und institutionell verfestigten Entwürfen von wünschenswerten oder beklemmenden Zukunftsvisionen verwoben. Dies schlägt sich auch in individuellen Erlebnischancen, ... [ mehr ]
Rezension von: Hans Werbik und Gerhard Benetka (2016). Kritik der Neuropsychologie (PDF)
Vertraulichkeit in der psychoanalytischen Beziehung und die Veröffentlichung von Fallberichten (PDF)
Wie lassen sich Vertraulichkeit als Voraussetzung psychoanalytischer Behandlung und die Notwendigkeit, Erkenntnisse aus Behandlungen im wissenschaftlichen Austausch mitzuteilen, vereinbaren? Die Bitte an Patienten um Zustimmung zur Veröffentlichung von Fallmaterial ist nicht unproblematisch. Fernbehandlungen mithilfe moderner Medien erfordern eine noch weiter erhöhte Sensibilität für diese Fragen.
Abstract:
How to integrate confidentiality as an ... [ mehr ]
Psychoanalyse der Geschichte (PDF)
Der französische Zeithistoriker diskutiert die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit von Geschichte und Psychoanalyse ausgehend von der Neubegründung seines Faches im 19. Jahrhundert durch Leopold von Ranke (Historismus) über die Blickveränderungen, die Maurice Halbwachs (kollektive Erinnerung), Max Weber (Objektivitätsfragen) und Marc Bloch (Annales-Schule) eingeführt haben. Er stellt vier Bereiche vor, in denen die Psychoanalyse – insbesondere ... [ mehr ]
»Es war alles transit in unserem Leben« (PDF)
Wenn innere Modelle von primären Beziehungserfahrungen im Lichte neuer Erfahrungen umstrukturiert werden müssen, verändern sich auch die identifikatorischen Bezugnahmen auf ›Väterlichkeit‹ und ›Mütterlichkeit‹ und bringen die kulturell austarierten ›Männlichkeits‹und ›Weiblichkeitsentwürfe‹ ins Wanken. Literarische Repräsentationen leuchten die Möglichkeitsräume von ... [ mehr ]