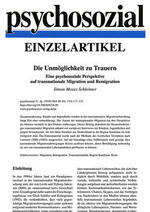psychosozial
Das Unbehagen in der Moderne (PDF)
Untersucht wird der wachsende Populismus in westlichen Demokratien. Er verdankt sich einem tiefen Unbehagen am globalisierten Kapitalismus. Im Bewusstsein revolutionären Widerstands proben populistische Bewegungen den vergeblichen Aufstand gegen das Zusammenwachsen der Welt. In den unvermeidlich entstehenden kulturellen, weltanschaulichen und religiösen Nähekonflikten verteidigen sie die eigene Identität. Unter diesem relationalen Blickwinkel zeigen sich ... [ mehr ]
Interpersonalität und Konversation - Voraussetzungen für eine Theorie (PDF)
Der »relational turn« hat sich, ausgehend von starken Anstößen durch Steven Mitchell und seine Gruppe, seit den 1990er Jahren enorm ausgebreitet. Auf der anderen Seite gibt es in der Psychoanalyse eine stärkere Tendenz der Rückentwicklung zu non-relationalen Positionen, zum Kleinianismus und zu monadischen Denkformen. Ich diskutiere an einem Beispiel zunächst die Form der Auseinandersetzung, gehe dann auf einige Theorieprobleme ein und ... [ mehr ]
Psychotherapie als echter Dialog (PDF)
Das intersubjektive Verständnis der therapeutischen Beziehung nimmt den Begriff des Dialogs ernst und fasst das psychotherapeutische Gespräch als einen Dialog im emphatischen Sinne auf. Der Therapeut verlässt seine Position als neutraler und distanzierter Beobachter und als fachliche Autorität und entwickelt gemeinsam mit dem Patienten ein neues Verständnis von dessen Lebensund Leidensgeschichte. Deutungen und Bedeutungen werden von beiden in einem ... [ mehr ]
Beziehung und Beziehungsarbeit (PDF)
Zunächst werden zwei für Psychiatrie und Psychotherapie grundlegende Begriffe, Beziehung und Begegnung, definiert und voneinander unterschieden. Im zweiten Teil soll ein besonderes, nicht-klinisches, literarisches Beispiel für eine verfehlte Begegnung vorgestellt werden. Der dritte Teil widmet sich dem Begriff der Beziehungsarbeit. Anschließend werden Formen der Beziehungsarbeit unterschieden, vor allem die Arbeit mit und die Arbeit an der Beziehung. Der ... [ mehr ]
Leben können mehr als einer (PDF)
Mit den hier vorgestellten Überlegungen versucht die Autorin, ihre psychoanalytisch-theoretische Sichtweise zu Erfahrungen in Beziehung zu setzen, die sie in vielen Gegenden der Welt gemacht hat, wo ihre Kollegen und Kolleginnen mit den Folgen von Gewalt und kollektiven Traumata ringen. Untersucht werden die Auswirkungen solcher Traumatisierungen im Licht der Erfahrungen mit Dialogen im Mittleren Osten wie auch unter Berücksichtigung von Gesprächen mit Kolleginnen ... [ mehr ]
Die Relationale Psychoanalyse und das Intersubjektivitätsparadigma (PDF)
Der Autor beschreibt zunächst die Entwicklung der Intersubjektivitätstheorie als eines neuen Paradigmas der Psychoanalyse im Sinne von Kuhn, danach die wesentlichen Elemente der Relationalen Psychoanalyse als einer Form der Intersubjektivitätstheorie. Er untersucht das schwierige Verhältnis zwischen Mainstream und Relationaler Psychoanalyse und weist auf neuere Entwicklungen einer umfassenden psychoanalytischen Feldtheorie als möglichen neuen Common ... [ mehr ]
Editorial. Beziehung, das Unbewusste und die Psychoanalyse (PDF)
»Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich vor allem in ihrem Umgang mit Fremden und Traumatisierten …« (PDF)
Es wird auf die Erfahrung psychoanalytischer Traumaforscher, wie unter anderem von Dori Laub, hingewiesen, dass der Umgang mit Fremden und Traumatisierten als Indikator für die Humanität einer Gesellschaft betrachtet werden kann. Daher stimmt die zunehmende Entsolidarisierung mit dem Leid heutiger Geflüchteter nachdenklich. Mit einigen konkreten Berichten aus der Arbeit mit Geflüchteten in der Erstaufnahmeeinrichtung »Michaelisdorf« (Darmstadt) ... [ mehr ]
Die Attraktivität der sowjetischen Vergangenheit und ein Neubeginn (PDF)
Die Nachwirkung der Vergangenheit gilt als unbestritten, doch ihre konkreten Formen und vor allem ihr Zusammenhang mit den kulturell verankerten Zeitperspektiven lassen viele Fragen offen. Am Beispiel der postsowjetischen Gesellschaft Russlands und anhand von Befunden aus einer von der Autorin durchgeführten Studie werden im folgenden Beitrag einige dieser Fragen diskutiert. Der Fokus der Betrachtung liegt auf Ambivalenzen und Widersprüchen in der Wahrnehmung der ... [ mehr ]
Franz Werfels Novelle Die andere Seite (PDF)
Drei an der Tiefenhermeneutik orientierte Interpreten wenden sich arbeitsteilig der Novelle Die andere Seite (1916) von Franz Werfel zu: Achim Würker unterzieht sie nach den methodischen Vorgaben Alfred Lorenzers einer tiefenhermeneutischen Analyse. Helmwart Hierdeis geht der »Nachträglichkeit« in Werfels literarischem Rückblick auf eine Szene in seiner Kindheit und, dadurch angeregt, einer eigenen Kindheitserinnerung nach. Hans Jörg Walter ... [ mehr ]
Noch einmal, anders (PDF)
Der Beitrag exploriert den infrage stehenden Zusammenhang im Kontext von Sterbeerzählungen. Im Anschluss an die Diskussion der narrationsbezogenen Lebensendforschung werden auf der Grundlage einer systematischen Unterscheidung von Sterbeerzählungen und Sterbenarrativen zwei Erzählungen textnahe untersucht. An Tolstois Tod des Iwan Iljitsch lässt sich das Moment des Neubeginns exemplarisch innerhalb des Narrativs der gelockerten Innen-Außen-Beziehung ... [ mehr ]
»… es gibt keinen neuen Anfang, nur Fortsetzungen« (PDF)
Die Autobiografie weiter leben. Eine Jugend (1992) von Ruth Klüger und der Roman von Imre Kertész Roman eines Schicksallosen (1996) verweisen nicht nur auf ein breites Spektrum literarischer Auseinandersetzungen mit der Shoah, mit ihnen steht auch die Verbindung von Nachträglichkeit und Neubeginn zur Disposition. Zwei Textelemente werden hierbei von Bedeutung sein, die »Gespenster« (Klüger) und die »Schritte« (Kertész). Im ... [ mehr ]
Mit den Tränen ringen (PDF)
Die Psychologie des Gedächtnisses zeigt, dass Menschen ihre subjektive Vergegenwärtigung und soziale Darstellung der eigenen Vergangenheit einer steten Revision unterwerfen. Von besonderer Brisanz ist das dort, wo Menschen im Nachhinein mit dem Vorwurf der Täterschaft konfrontiert werden. Anhand einer Einzelfallanalyse führt der Beitrag aus, welche Strategien der kommunikativen Verantwortung den Beschuldigten in solchen Fällen zur Verfügung stehen. ... [ mehr ]
Macht und Ohnmacht des Verzeihens (PDF)
Nach einem kurzen Rückblick auf die Philosophiegeschichte legt der Autor die komplexe Struktur des Verzeihungsvorgangs frei. Das »entgegenkommende« Verzeihen der in ihrer Integrität verletzten Person hat die Kraft, aufseiten des Schädigers den Mut zur Selbstkonfrontation und zur Reue zu evozieren. Die Komplexität dieser extrem fragilen Kommunikation führt an die Grenzen der Versprachlichung. Geklärt wird auch das Verhältnis von ... [ mehr ]
»Mein neues altes Leben« (PDF)
Psychoanalytische Psychotherapie ist heute auf die Förderung von Entwicklung über die gesamte Lebensspanne ausgerichtet. Zu den Therapiezielen jüngerer Menschen kommt mit dem Älterwerden die Auseinandersetzung mit den Lebensmöglichkeiten angesichts von Veränderungen des Körpers und der Endlichkeit hinzu. Dabei stellt das Bedürfnis nach Rückblick auf das gelebte Leben Nachträglichkeit ins Zentrum therapeutischer Reflexion. ... [ mehr ]
Wie wird Neues möglich in der Psychotherapie? (PDF)
Die Psychoanalytiker der ersten Generationen verfolgten zunächst die aufklärerische Idee, dass Menschen sich von ihren Krankheitssymptomen befreien, indem sie die Macht des Vergangenen, insbesondere die Wirkung früher traumatisierender Erfahrungen dadurch überwinden, dass sie sich Unbewusstes bewusst machen. Heute soll der Patient verstehen, wie er seine soziale Welt subjekthaft konstruiert und wie er – auch in der therapeutischen Beziehung – ... [ mehr ]
Nachträglichkeit, Wiederholung, Neubeginn (PDF)
Ausgehend von einer literarischen Darstellung der Zeitfigur der Nachträglichkeit (Walter Benjamin) wird zunächst anhand der Fallgeschichte »Emma« aus dem »Entwurf einer Psychologie« (Freud, 1950c [1895]) das Konzept der Nachträglichkeit bei Freud dargestellt, wobei die Zeitlichkeit und die Bedeutung der Sexualität im Fokus stehen. Anschließend wird diskutiert, inwiefern auch die Rezeptionsgeschichte der Nachträglichkeit ein ... [ mehr ]
Die Unmöglichkeit zu Trauern (PDF)
Kinder und Jugendliche wurden in der internationalen Migrationsforschung lange Zeit eher vernachlässigt. Der Ansatz der transnationalen Migration hat ihre Perspektive als Akteure verstärkt in den Diskurs einbezogen. Dieser Beitrag diskutiert die Herausforderungen transnationaler Migration anhand von narrativen Interviews mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die mit ihren Familien aus Deutschland in die Region Kurdistan im Irak remigriert sind. Das ... [ mehr ]
Die Mitte der Nation (PDF)
In den Ermittlungen zur Mordserie des NSU ist eine eklatante Blindheit der Sicherheitsbehörden in der Wahrnehmung von Rassismus sichtbar geworden. Es stellt sich daher die Frage, ob die Kategoriensysteme zur Erfassung rassistischer Gewalt ausreichend sind. Der sogenannten »Extremismustheorie« kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu. Ausgehend von einer Sozialpsychologie des Nationalgefühls kann gezeigt werden, dass die Kategorie der »Mitte«, ... [ mehr ]
Child Survivors in Deutschland (PDF)
Die Child Survivors, deren seelische Entwicklung am nachhaltigsten von der Nazi-Verfolgung geprägt und beschädigt wurde, werden oftmals noch heute nicht wahrgenommen und anerkannt. Während Tilo Held in der Zeitschrift Psyche (8/2014) über eben diese Gruppe erklärte, »die Zeit ihrer Implikation in Forschungsprojekte ist vorbei«, widmen sich die Autoren mit ihrer Forschungsarbeit den psychosozialen Spätfolgen der Verfolgung der Child ... [ mehr ]
Morgen, morgen, nur nicht heute … (PDF)
Ausgehend von dem Befund, dass mit dem Einsetzen der psychologischen Forschung zur Prokrastination ein Bedeutungswandel von einer neutralen bis positiven Konnotation zu einer überwiegend negativen Konnotation stattgefunden hat, wird Prokrastination zunächst begriffsgeschichtlich eingeordnet und so die psychologische Engführung als Arbeitsstörung erweitert. Anschließend wird die psychologische Prokrastinationsforschung vorgestellt und dafür ... [ mehr ]
Transkulturelle Entwicklung des Prokrastinationskonzepts (PDF)
Das Konzept Prokrastination beinhaltet positive und negative Seiten, die in verschiedenen Epochen und Kulturen anders bewertet werden, von dem antiken Rom bis heute, von Westen bis Osten. Wir werden diese Aspekte betrachten und versuchen sie zu verstehen, möglichst unabhängig von moralischen Vorurteilen. Die Entwicklung dieser moralischen Dogmen ist auch wichtig für uns, um zu begreifen, was für eine soziale Funktion die Prokrastination in verschiedenen ... [ mehr ]