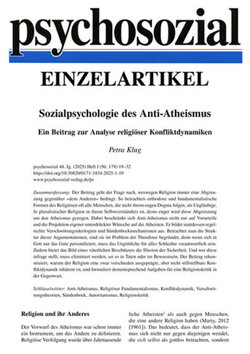14 Seiten, PDF-E-Book
Erschienen: April 2025
Bestell-Nr.: 26763
https://doi.org/10.30820/0171-3434-2025-1-19
abonnieren
Petra Klug
Sozialpsychologie des Anti-Atheismus (PDF)
Ein Beitrag zur Analyse religiöser Konfliktdynamiken
Sofortdownload
Dies ist ein E-Book. Unsere E-Books sind mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen,
jedoch frei von weiteren technischen Schutzmaßnahmen (»DRM«).
Erfahren Sie hier mehr zu den Datei-Formaten.
Der Beitrag geht der Frage nach, weswegen Religion immer eine Abgrenzung gegenüber »dem Anderen« bedingt. So betrachten orthodoxe und fundamentalistische Formen des Religiösen oft alle Menschen, die nicht ihrem engen Dogma folgen, als Ungläubige. Je pluralistischer Religion in ihrem Selbstverständnis ist, desto enger wird diese Abgrenzung um den Atheismus gezogen. Dabei beschränkt sich Anti-Atheismus nicht nur auf Vorurteile und die Projektion eigener unterdrückter Wünsche auf die Atheisten. Er bildet stattdessen regelrechte Verschwörungsideologien und Sündenbockmechanismen aus. Betrachtet man die Struktur dieser Argumentationen, sind sie im Problem der Theodizee begründet, denn wenn sich in Gott nur das Gute personifiziert, muss das Ungöttliche für alles Schlechte verantwortlich sein. Zudem bietet das Bild eines väterlichen Beschützers die Illusion der Sicherheit. Und wer diese infrage stellt, muss eliminiert werden, sei es in Taten oder im Bewusstsein. Der Beitrag rekonstruiert, warum der Religion eine zwar verschieden ausgeprägte, aber nicht stillstellbare Konfliktdynamik inhärent ist, und formuliert dementsprechend Aufgaben für eine Religionskritik in der Gegenwart.
Abstract:
The article explores the question of why religion inherently involves a demarcation against »the other«. Orthodox and fundamentalist forms of religiosity, for instance, often regard all those who do not adhere to their narrow dogma as unbelievers. The more pluralistic a religion’s self-understanding becomes, the more narrowly this demarcation focuses on atheism. Anti-atheism, however, is not limited to prejudice and the projection of suppressed desires onto atheists. Instead, it develops into full-fledged conspiracy ideologies and scapegoating mechanisms. Examining the structure of these arguments reveals that they are rooted in the problem of theodicy. If God embodies only the good, then the ungodly must be held responsible for all that is evil. Moreover, the image of a paternal protector offers the illusion of security, and anyone who questions this illusion must be eliminated – whether in deeds or in consciousness. The article reconstructs why religion inherently possesses a conflict dynamic that, while varying in intensity, cannot be entirely neutralized. It then outlines corresponding tasks for contemporary critique of religion.
Abstract:
The article explores the question of why religion inherently involves a demarcation against »the other«. Orthodox and fundamentalist forms of religiosity, for instance, often regard all those who do not adhere to their narrow dogma as unbelievers. The more pluralistic a religion’s self-understanding becomes, the more narrowly this demarcation focuses on atheism. Anti-atheism, however, is not limited to prejudice and the projection of suppressed desires onto atheists. Instead, it develops into full-fledged conspiracy ideologies and scapegoating mechanisms. Examining the structure of these arguments reveals that they are rooted in the problem of theodicy. If God embodies only the good, then the ungodly must be held responsible for all that is evil. Moreover, the image of a paternal protector offers the illusion of security, and anyone who questions this illusion must be eliminated – whether in deeds or in consciousness. The article reconstructs why religion inherently possesses a conflict dynamic that, while varying in intensity, cannot be entirely neutralized. It then outlines corresponding tasks for contemporary critique of religion.
Jürgen StraubS. 5–18Editorial (PDF)
Wandel, Ansprüche und Themen der Religionskritik - und ihrer KritikPetra KlugS. 19–32Sozialpsychologie des Anti-Atheismus (PDF)
Ein Beitrag zur Analyse religiöser KonfliktdynamikenHeidemarie WinkelS. 33–46Feministische Religionskritik (PDF)
Jürgen StraubS. 47–76Psychoanalytische Religionskritik im Zeichen des säkularistischen und rationalistischen Dogmas (PDF)
Eine kritische Lektüre von Sigmund Freuds AnsatzKnut Martin StünkelS. 77–87Metaphern der Religionskritik (PDF)
Beispiele religionskritischer Sinnbildung bei Karl Marx und Christopher HitchensSabrina Gamali, Natalie Rodax, Jan Aden & Anastasiya Bunina S. 91–102Mehrheitsgesellschaftliche Einstellungen gegenüber konvertierten und nicht-konvertierten Musliminnen in Österreich (PDF)
Roland KaufholdS. 103–107Rezension von: Myron Sharaf (2022). Wilhelm Reich - Erforscher des Lebendigen (PDF)
Moritz WullenkordS. 108–111Rezension von: Alexandra Schauer (2023). Mensch ohne Welt (PDF)
Insa FookenS. 112–114Rezension von: Agnes Justen-Horsten (2022). On the Move (PDF)
Wandel, Ansprüche und Themen der Religionskritik - und ihrer KritikPetra KlugS. 19–32Sozialpsychologie des Anti-Atheismus (PDF)
Ein Beitrag zur Analyse religiöser KonfliktdynamikenHeidemarie WinkelS. 33–46Feministische Religionskritik (PDF)
Jürgen StraubS. 47–76Psychoanalytische Religionskritik im Zeichen des säkularistischen und rationalistischen Dogmas (PDF)
Eine kritische Lektüre von Sigmund Freuds AnsatzKnut Martin StünkelS. 77–87Metaphern der Religionskritik (PDF)
Beispiele religionskritischer Sinnbildung bei Karl Marx und Christopher HitchensSabrina Gamali, Natalie Rodax, Jan Aden & Anastasiya Bunina S. 91–102Mehrheitsgesellschaftliche Einstellungen gegenüber konvertierten und nicht-konvertierten Musliminnen in Österreich (PDF)
Roland KaufholdS. 103–107Rezension von: Myron Sharaf (2022). Wilhelm Reich - Erforscher des Lebendigen (PDF)
Moritz WullenkordS. 108–111Rezension von: Alexandra Schauer (2023). Mensch ohne Welt (PDF)
Insa FookenS. 112–114Rezension von: Agnes Justen-Horsten (2022). On the Move (PDF)
»Eine gewichtige Publikation ...«
Christian Geyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung am 27. Mai 2025
»eine gewichtige Publikation ...«
Christian Geyer, FAZ.de am 27. Mai 2025